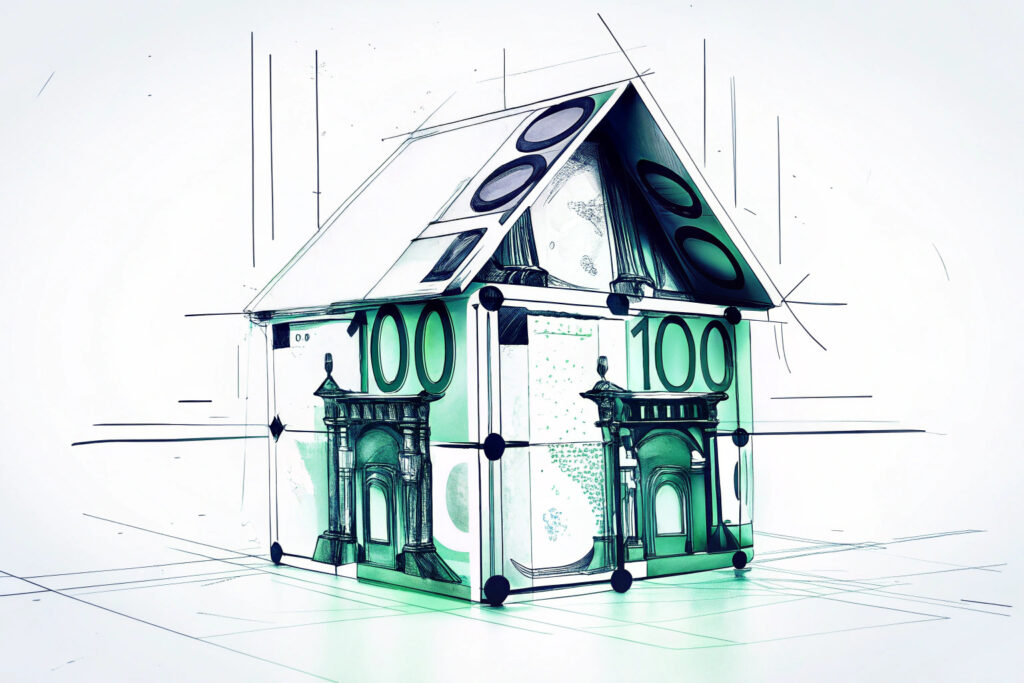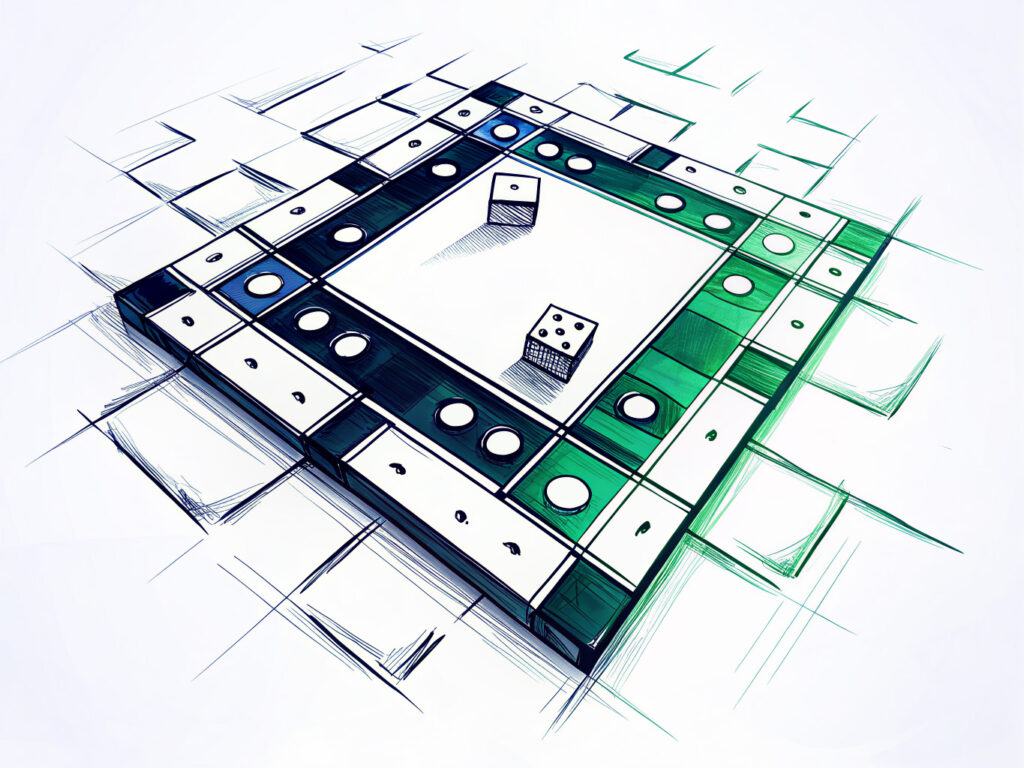Was ist Selbstgeldwäsche?
Von diesem Grundsatz macht der Gesetzgeber in § 261 Abs. 7 StGB eine Ausnahme, indem er den dort angeführten Strafausschließungsgrund für den Tatbeteiligten einschränkt. Die Vorschrift lautet wie folgt:
(7) Wer wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist, wird nach den Absätzen 1 bis 6 nur dann bestraft, wenn er den Gegenstand in den Verkehr bringt und dabei dessen rechtswidrige Herkunft verschleiert.
Dies geht auf eine Änderung noch der alten Gesetzesfassung im Jahre 2015 zurück. Begründet wurde dies im Wesentlichen wie folgt (Drucksache 18/6389, S 11):
„Das im Verschleiern angelegte Täuschungselement hat zusätzliche Auswirkungen auf die Marktteilnehmer und das allgemeine Vertrauen in den legalen Finanz- und Wirtschaftsverkehr. Solche Handlungen gefährden die Integrität des Wirtschafts- und Finanzkreislaufs und damit ein gegenüber der Vortat zusätzliches Rechts gut, auf dessen Schutz auch Vortatbeteiligte verpflichtet werden können.“
Ob dies überzeugend ist, sei dahingestellt. Gegen die Strafbarkeit der Selbstgeldwäsche sind immer wieder verfassungsrechtliche Bedenken erhoben worden, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des Doppelbestrafungverbots. Diese hat der BGH allerdings (mit nachvollziehbaren Argumenten) zurückgewiesen (BGH, Beschluss vom 27.11.2018 – 5 StR 234/18).
Problematik der Vortatbeteiligung
Ein bewusst vereinfachtes Beispiel verdeutlicht die grundlegende Problematik: der Einbrecher, der seine Beute im Wald vergräbt, um sie so zu verbergen, verwirklicht kein strafwürdiges Unrecht. Der Tatbestand des § 261 Abs. 1 Nr. 1 StGB ist zwar erfüllt, weil einer rechtswidrigen Tat herrührender Gegenstand verborgen wird. Nach Abs. 7 ist eine Strafbarkeit jedoch abzulehnen. Die Strafbarkeit der Vortat genügt vollständig, um den Unrechtsgehalt der Tat zu erfassen. In dem bloßen Verbergen der Beute sieht auch der Gesetzgeber kein zusätzliches Unrecht, da es bereits an einem Inverkehrbringen fehlt.
Prinzip der „mitbestraften Nachtat“
Strafrechtlich ist dies anerkannt als das Prinzip der mitbestraften Nachtat, deren Unrechtsgehalt regelmäßig oder notwendig in der Vortat bereits enthalten ist. Ein eigenständiges und strafwürdiges Unrecht kann insoweit mit guten Gründen verneint werden.
Eigenständiger Unrechtsgehalt bei manipulativer Verschleierung
Der Vorschrift des § 261 Abs. 7 StGB liegt der Gedanke zugrunde, dass auch der an der Vortat Beteiligte eigenständiges Unrecht dann verwirklicht, wenn er die rechtswidrige Herkunft im weiteren verschleiert – insoweit sei auf die zitierte Gesetzesbegründung verwiesen. Die Selbstgeldwäsche setzt prinzipiell ein manipulatives, aktiv auf Verschleierung gerichtetes Vorgehen voraus.
Einführung des all-crimes-Ansatzes
Eine wesentliche Erweiterung hat der Tatbestand der Geldwäsche ferner durch die Reform des Jahres 2021 erfahren. Insbesondere ist der bis zu diesem Zeitpunkt in der Vorschrift enthaltene Katalog von Vortaten weggefallen. Als Vortat kommt seither prinzipiell jede rechtswidrige Tat in Betracht. Dies bedeutet eine wesentliche Erweiterung der Strafbarkeit. Dies hat auch Bedeutung für § 261 Abs. 7 StGB: prinzipiell stellt sich die Frage nach der Selbstgeldwäsche mit Blick auf jede rechtswidrige Tat und den Umgang mit aus dieser rührenden Vermögenswerten. Jeder, der sich Vermögenswerte durch eine Straftat verschafft, kann sich nachfolgend wegen Selbstgeldwäsche strafbar machen.
Wann ist Selbstgeldwäsche strafbar?
§ 261 Abs. 7 StGB enthält zwei Voraussetzungen, unter denen der Strafausschließungsgrund nicht gilt: das Inverkehrbringen des in Rede stehenden Gegenstands und die Verschleierung seiner rechtswidrigen Herkunft.
Inverkehrbringen des bemakelten Gegenstandes
Der Begriff des Inverkehrbringens ist dabei durchaus weit. Der BGH definiert diesen unter Rückgriff auf die Gesetzesbegründung wie folgt (BGH, Beschluss vom 27.11.2018 – 5 StR 234/18, Rn. 20):
Erfasst werden sollen nach dem Willen des Gesetzgebers sämtliche Handlungen, die dazu führen, dass der Täter den inkriminierten Gegenstand aus seiner tatsächlichen Verfügungsgewalt entlässt und ein Dritter die tatsächliche Verfügungsgewalt über den Gegenstand erlangt.
Bei körperlichen Gegenständen – etwa gestohlenen Wertgegenstände, u.ä. – ist ein solches Inverkehrbringen ohne weiteres nachvollziehbar. Der Tatgegenstand der Geldwäsche ist jedoch wesentlich weiter und erfasst letztlich jeden Vermögenswert. Im Einzelfall kann die Definition des Inverkehrbringens daher durchaus schwierig sein.
Auch die Einzahlung von bemakelten Geldern auf ein Bankkonto stellt grundsätzlich ein Inverkehrbringen dar. Hiergegen ließe sich anführen, dass der Handelnde Verfügungsbefugnis behält. Formal steht im jedoch nur ein Auszahlungsanspruch gegenüber der Bank zu. Parallel werden im Grundsatz ähnliche Gestaltungen zu Krypto-Währungen, etc. zu beurteilen sein; entscheidend kommt es aber auch insoweit auf die (technischen) Gegebenheiten im Einzelfall an.
Verschleierung der rechtswidrigen Herkunft
Das zentrale Merkmal der Vorschrift dürfte das Verschleiern der rechtswidrigen Herkunft des jeweiligen Vermögensgegenstandes sein. Dies folgt schon aus der oben zitierten Gesetzesbegründung, die gerade hier in den Grund für die Strafbarkeit gesehen hatte. Ein Verschleiern liegt dann vor, wenn die Aufdeckung der rechtswidrigen Herkunft durch eine Handlung erschwert wird. In welcher Weise dies geschieht, ist grundsätzlich ohne Belang. Vielfach wird dies mit einem klandestinen und manipulativen Vorgehen verbunden sein. Wer beispielsweise einer Bank gegenüber auf Nachfrage nach der Herkunft von Vermögenswerten falsche Angaben macht und diese durch gefälschte Belege untermauert, verschleiert im Sinne der Vorschrift. Solche Nachfragen sind im Zuge der verschärften Geldwäscheaufsicht nicht selten.
Die bloße Nutzung – etwa von bemakeltem Bargeld – zum eigenen Vorteil stellt als solche noch kein Verschleiern dar. Es fehlt insoweit an dem täuschenden Element. Das bloße Verschweigen der rechtswidrigen Herkunft genügt insoweit nicht.
case study 1: BGH, Urteil vom 19. November 2024 – 5 StR 401/24
Die Funktion des Strafausschließungsgrundes beleuchtet die Entscheidung des BGH vom 19. November 2024 – 5 StR 401/24. Dem Angeklagten waren Betrugshandlungen zu Lasten von Unternehmen vorgeworfen worden. Diese erhielten Anrufe, im Rahmen derer diese zu eiligen Überweisungen auf von den Tätern benannte Konten bewegt wurden. Der Angeklagte hatte die hierfür genutzten Konten organisiert, indem er Dritte – die sog. Finanzagenten – zur einmaligen Bereitstellung ihres Kontos gewonnen hatte. Der BGH verneinte eine Strafbarkeit nach § 261 StGB (Rn. 12):
Der Strafaufhebungsgrund des § 261 Abs. 7 StGB greift zugunsten des Angeklagten, weil er an den Vortaten – den Betrugshandlungen – beteiligt war. Die Überweisungen auf die Konten der „Finanzagenten“ waren als die maßgeblichen Vermögensverfügungen Tathandlungen des Betruges und stellten deshalb kein Inverkehrbringen im Sinne von § 261 Abs. 7 StGB dar. Eine strafbare Selbstgeldwäsche, also eine Geldwäschehandlung mit Unrechtssteigerung (vgl. BGH, Beschluss vom 27. November 2018 – 5 StR 234/18, BGHSt 63, 268 Rn. 11) lag auch nicht in den Weiterleitungen an den Hintermann, weil das Erlangen der tatsächlichen Verfügungsgewalt durch einen Mittäter ohne zusätzliche Verschleierungshandlungen dafür regelmäßig nicht genügt (vgl. BGH, Beschluss vom 15. August 2023 – 5 StR 177/23, NStZ 2024, 90, 91; MüKo-StGB/Neuheuser, 4. Aufl., § 261 Rn. 134).
case study 2: BGH, Beschluss vom 27.11.2018 – 5 StR 234/18
Der genannte Beschluss stellt eine frühe Leitentscheidung des BGH dar. Er illustriert in besonderer Weise, wie weit eine Strafbarkeit wegen Selbstgeldwäsche reichen kann. Daher soll er hier in seinen Grundzügen vorgestellt werden: Der Angeklagte war zuvor u.a. wegen Steuerhinterziehung zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Gegenstand des Verfahrens war insbesondere die Hinterziehung von Tabaksteuer in Millionenhöhe. Im offenen Vollzug bzw. nach seiner Entlassung nutze er weiter aus den abgeurteilten Taten stammende Gelder zur Finanzierung seines Lebensstils.
Hierzu wurden aus den Taten herrührende Beträge auf ein Konto eingezahlt, welches einer dritten Person D. zugeordnet war. Wirtschaftlich diente das Konto jedoch dem Angeklagten und seiner Familie. Von dem Konto wurden insbesondere die Miete sowie andere Ausgaben des täglichen Bedarfs beglichen. Formal trat nach außen die dritte Person als Berechtigte und Urheberin der Zahlungen auf.
Der BGH stellte insoweit klar, dass die Einzahlung bzw. Überweisung von bemakelten Geldern auf das Konto der D. ein Inverkehrbringen unter Verschleierung der rechtswidrigen Herkunft bedeute. Hierzu führte der Senat zentral aus (Rn. 23):
Das Verschleiern der Herkunft eines Gegenstands umfasst alle zielgerichteten, irreführenden Machenschaften mit dem Zweck, einem Tatobjekt den Anschein einer anderen (legalen) Herkunft zu verleihen oder zumindest seine wahre Herkunft zu verbergen (vgl. BGH, Urteil vom 27. Juli 2016 – 2 StR 451/15, NStZ 2017, 28). Die Eingänge beruhten auf vom Angeklagten veranlassten Bareinzahlungen ohne Nennung eines Einzahlers oder Verwendungszwecks, legendierten Überweisungen und Rückzahlungen von zuvor aus den Erträgen der Vortaten gewährten Darlehen und daraus gezogenen Nutzungen
Auch die späteren Verfügungen über das Kontoguthaben stellten grundsätzlich Geldwäschehandlungen dar. Bemerkenswert ist schließlich weiter, dass das Konto nicht ausschließlich aus den Taterträgen gespeist wurde. So ließen sich auch Überweisungen aus legalen Quellen feststellen. Nach der Theorie der Gesamtkontamination erstreckt sich die Bemakelung auf das gesamte Kontoguthaben, wenn der aus rechtswidrigen Quellen herrührende Anteil nicht ganz untergeordnet ist.
Strafe bei Selbstgeldwäsche
Die Strafzumessung folgt den gleichen Grundsätzen wie allgemein bei der Geldwäsche. Ein zentraler Strafzumessungsgesichtspunkt ist die Höhe der in Rede stehenden Vermögenswerte. Gerade bei der Selbstgeldwäsche werden auch Grad und Ausmaß der Verschleierung eine Rolle spielen. Möglicherweise sind auch weitere Delikte – insbesondere Urkundendelikte durch Vorlage gefälschter Unterlagen – verwirklicht.
Strafzumessung erfolgt immer im Rahmen einer Gesamtabwägung der relevanten Umstände des Einzelfalls. Straftaten nach § 261 StGB werden – gerade nach der gesetzgeberischen Betonung der Vorschrift – durchaus empfindlich geahndet. Bemerkenswert ist beispielsweise an der Entscheidung BGH, Beschluss vom 27.11.2018 – 5 StR 234/18, dass das Landgericht den Angeklagten immerhin zu einer vollstreckbaren Freiheitsstrafe verurteilt hatte, obwohl die in Rede stehenden Beträge nicht allzu hoch waren und ein Bezug zur Vortat gegeben war.
Ein besonderes Risiko besteht in einem möglichen Bewährungswiderruf. Ist wegen der Vortat bereits eine Bewährungsstrafe ausgesprochen worden, so kann die nachfolgende Verurteilung wegen Geldwäsche zum Widerruf dieser Bewährung führen. Auch im (offenen) Vollzug an die Existenz des Weiteren, allein wegen Selbstgeldwäsche geführten Verfahrens zu erheblichen Problemen führen.
Einziehung nach § 261 Abs. 10 StGB
Auch die finanziellen Folgen einer Verurteilung wegen Geldwäsche können einschneidend sein. Denn über das Rechtsinstitut der Einziehung nach §§ 73 ff. StGB greift der Staat auf Vermögenswerte zu. Zentral ist dabei der Begriff des Erlangten; hierunter versteht die Rechtsprechung grundsätzlich jeden Zufluss während der Tat. Ist das Erlangte zum Zeitpunkt des Urteils nicht mehr im Vermögen des Betroffenen vorhanden, wird die Einziehung von Wertersatz anzuordnen sein. Die finanziellen Folgen einer Verurteilung wegen Selbstgeldwäsche können erheblich sein.
Zusammenfassung
Die sogenannte Selbstgeldwäsche nach § 261 Abs. 7 StGB bedeutet eine Ausdehnung der Strafbarkeit. Auch der Tatbeteiligte, welcher mit aus der Straftat herrührenden Vermögenswerten umgeht, hat durchaus ein Risiko einer weiteren Strafbarkeit. Der Gesetzgeber hat dies als kriminalpolitisch unverzichtbar angesehen. Nicht selten ergeben sich dabei schon aus den Ermittlungen zur Vortat Hinweise auf den nachfolgenden Umgang mit dem vermakelten Vermögen. Die Folgen einer Verurteilung können aus unterschiedlichen Gründen einschneidend sein; umso mehr ist frühzeitige Verteidigung geboten.