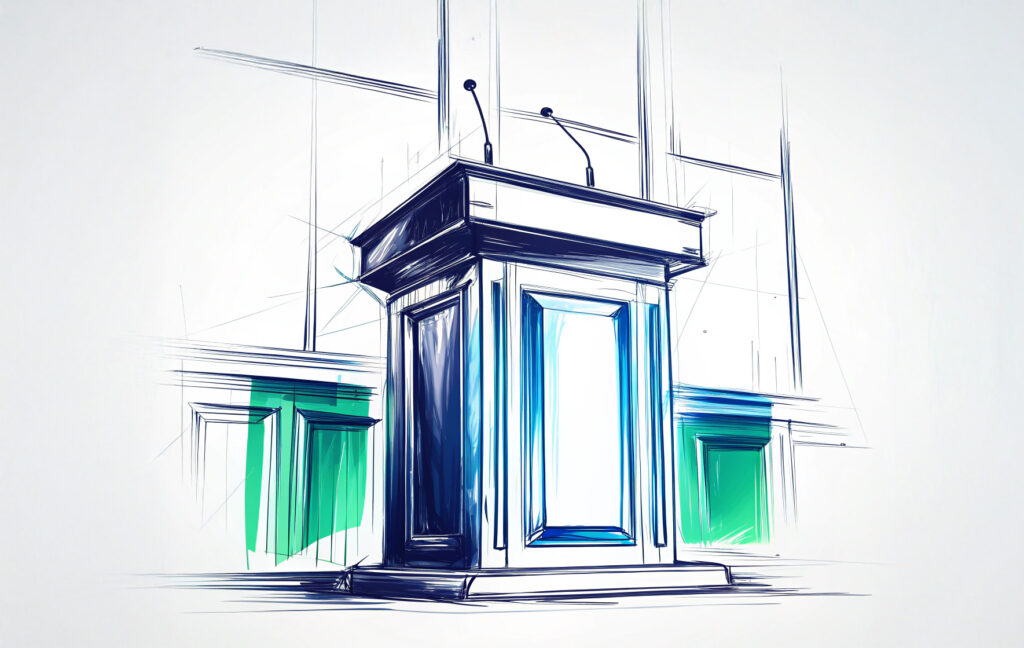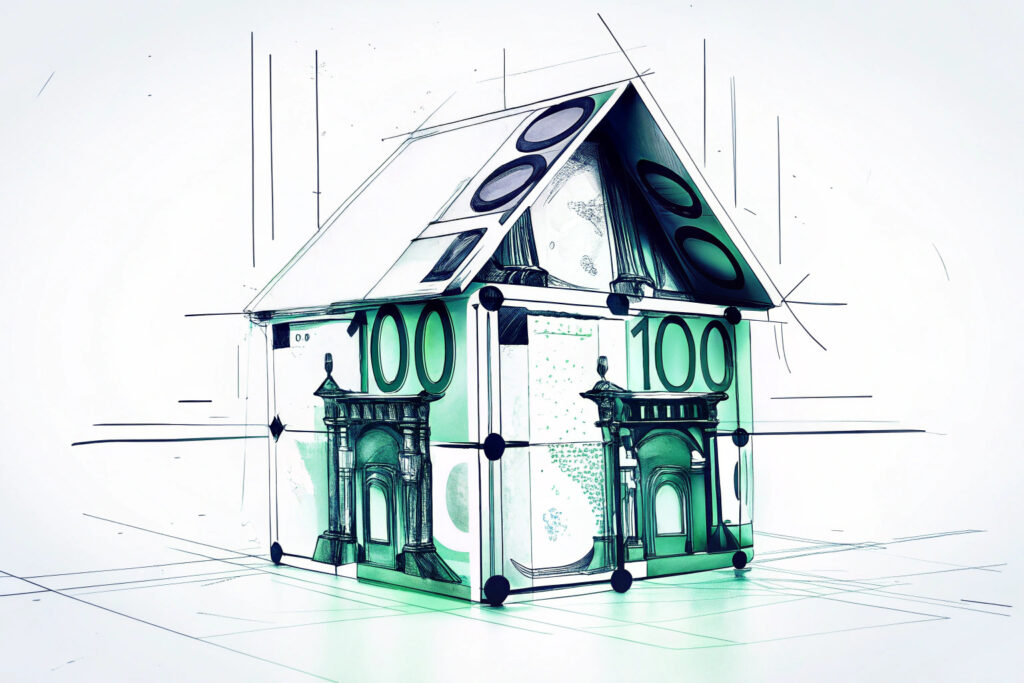Einleitung
Kaum ein Tatbestand ist derart umstritten wie die Geldwäsche nach § 261 StGB. Auch die strafrechtliche Verfolgung der Geldwäsche nimmt immer weiter zu. Die Zahl der Verdachtsanzeigen liegt weiterhin auf hohem Niveau, während die Anzahl der Analyseberichte nach dem Jahresbericht der Financial Intelligence Unit 2023 ganz erheblich gestiegen ist. Die Definition der Geldwäsche im Sinne des § 261 StGB hat über § 1 Abs. 1 GwG auch unmittelbar Bedeutung für die Anwendbarkeit der Regelung des Geldwäschegesetzes.
Es handelt sich bei der Geldwäsche um eine sehr weitreichende, in Grenzbereichen unscharf definierte Vorschrift. Die Praxis hat zudem eine Tendenz, die Anwendbarkeit der Vorschrift auszudehnen. Dies ist auch in den grundlegenden kriminalpolitischen Vorgaben begründet.
Problembereiche des Geldwäschetatbestands
Im Rahmen des Vortrages habe ich mich auf Problembereiche konzentriert, in welchen die Ausdehnung des Geldwäschetatbestandes besonders deutlich wird. Es ging dabei im Wesentlichen darum, dieses schlagwortartig zu beleuchten. Denn wie weit der Geldwäschetatbestand im Einzelnen reichen kann, ist oft unbekannt – und in den Details der Auslegung auch schwer übersehbar. Dies reicht von der weiten Definition des Tatgegenstands zu der Theorie der Totalkontamination bis hin zur sogenannten Selbstgeldwäsche.
Im Einzelnen habe ich mich auf folgende Bereiche konzentriert:
- Tatgegenstand
- Finanzagenten
- Totalkontamination
- Selbstgeldwäsche
- Subjektiver Tatbestand
- Selbständige Einziehung
Was ist Tatgegenstand der Geldwäsche?
Grundsätzlich ist jeder Vermögenswert ein potentieller Tatgegenstand der Geldwäsche. Rechtsprechung verlangt lediglich einen bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise kausalen Zusammenhang seiner rechtswidrigen Tat. Dies ist denkbar unscharf; insbesondere sollen auch Surrogate und wirtschaftliche Entsprechungen erfasst werden.
Praktische Probleme der strafrechtlichen Verfolgung von sogenannten Finanzagenten
Sogenannte Finanzagenten stellen rein praktisch den größten Teil der Verfahren wegen des Vorwurfs der Geldwäsche dar. Die praktischen Konstellationen sind dabei äußerst vielfältig. Ich habe die Anforderungen an die Feststellung eines bedingten Vorsatzes bzw. eines leichtfertigen Verhaltens erörtert. Problematisch stellt sich schließlich immer wieder die Frage der Einziehung des Erlangten. Wirtschaftlich trifft dies regelmäßig härter als die verhängte Strafe. Solange eine alleinige Verfügungsmacht über den betreffenden Vermögensgegenstand begründet ist, wenn auch nur kurzfristig, wird die Rechtsprechung von einem Erlangen im Sinne des Einziehungsrechts ausgehen.
Die Theorie der Totalkontamination
Kommt es zu einer Vermengung von legal erworbenen mit auf Straftaten zurückgehenden Vermögenswerten, stellt sich die Frage, wie hierauf zu reagieren ist. Die Rechtsprechung vertritt die Theorie der Totalkontamination, nach welcher auch der neu entstandene Vermögensgegenstand insgesamt als kontaminiert gilt, wenn der auf Straftaten zurückzuführen Anteil nicht völlig unerheblich ist. Anteile von einigen wenigen Prozent sollen hierzu nach der Rechtsprechung wohl bereits ausreichen. In der Praxis kann dies wirtschaftlich ganz erhebliche Auswirkungen haben.
Grundsätzlich wird wegen Geldwäsche nicht bestraft, wer bereits wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert in Verkehr gebracht wird und dabei dessen Herkunft verschleiert wird. Die Auslegung des Begriffs der Verschleierns reicht dabei weit. Insgesamt wird so ein Anknüpfungstatbestand geschaffen, nach dem auch ein bereits Tatbeteiligter zusätzlich wegen des späteren Umgangs mit Vermögenswerten belangt werden kann.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass das Verfahren der sogenannten selbstständigen Einziehung ganz weit reichende Möglichkeiten des staatlichen Zugriffs auf Vermögenswerte eröffnet- anknüpfend wiederum an die unscharfe Definition des § 261 StGB. Ohnehin ist das Einziehungsrecht sehr weitreichend und führt zu wirtschaftlich drastischen Folgen. Die Fassung des Geldwäschetatbestands leistet dem Vorschub.
Ausblick und Fazit
Es stehen weitere Verschärfungen des Geldwäscherechts sowie eine weitere Ausdehnung der strafrechtlichen Verfolgung zu erwarten. Welche Möglichkeiten der sehr unscharf definierte Tatbestand des § 261 StGB hierfür – der kriminalpolitischen Intention entsprechend – bietet, sollte im Rahmen dieses Vortrages aufgezeigt werden. Die Praxis der Strafverfolgungsbehörden sieht sich im Augenblick mit einer Vielzahl von Geldwäscheverfahren konfrontiert. Diese Vielzahl liegt auch in der Fassung des Tatbestands begründet, die der Vorschrift einen sehr weiten Anwendungsbereich verschafft. Ob die kriminalpolitisch gewollte Konzentration auf „organisisertes Verbrechen“ hierdurch gewahrt wird, darf bezweifelt werden.
Sollten Sie Fragen zu dem Vortrag haben, kontaktieren Sie mich gerne.