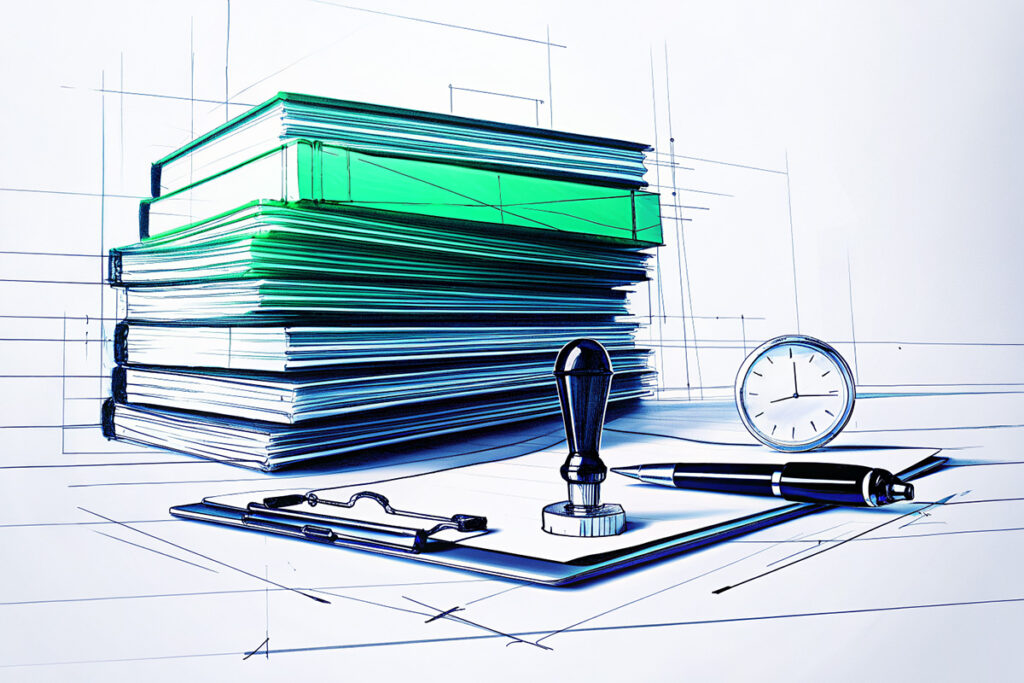Daher erfolgt im Weiteren eine erste Einordnung dieser für die Praxis und den Begriff des faktischen Geschäftsführers künftig wichtigen Entscheidung. Kritikwürdig ist dabei insbesondere die Tendenz der Entscheidung, die Strafbarkeit in unklarer Weise auszuweiten – auch wenn sich eine strafrechtliche Verantwortlichkeit des Firmenbestatters nachvollziehbar begründen lässt.
Faktische Geschäftsführer in der Rechtsprechung
Die Strafvorschriften des Insolvenzstrafrecht richten sich regelmäßig an den Geschäftsführer einer Gesellschaft. Oft geschieht dies vermittelt über die Zurechnungsnorm des § 14 StGB (Handeln für einen anderen).
Allerdings ist die Praxis der Bestellung von lediglich formalen Geschäftsführer weit verbreitet. Diese sind oft in die Geschäftstätigkeit in keiner Weise einbezogen und werden nur formal bestellt. Sie haben oft nicht einmal Kenntnis davon, welche Geschäfte das Unternehmen tätigt. Diese werden tatsächlich von dem sogenannten faktischen Geschäftsführer geführt, der lediglich formal (im Handelsregister) nicht auftritt. Dies kann darauf beruhen, dass Inhabilitätsgründe – insbesondere eine Vorverurteilung nach § 6 GmbHG – bestehen oder die Verantwortlichkeit aus sonstigen Gründen gerade verschleiert werden soll.
Kriterien in der Rechtsprechung
Der faktische Geschäftsführer wird strafrechtlich ebenso behandelt wie der eingetragene Geschäftsführer. Insbesondere gelten besondere insolvenzstrafrechtliche Pflichten auch für diesen. Damit kommt der Frage, welche Voraussetzungen an den Begriff zu stellen sind, strafrechtlich enorme Bedeutung zu. Die Rechtsprechung hat hierzu eine Reihe von Kriterien entwickelt, anhand derer zu beurteilt wird, ob jemand als faktischer Geschäftsführer zu betrachten ist. BayObLG, Urteil vom 20.02.1997 – 5 St RR 159/96 fasst dies grundlegend wie folgt:
„Selbst nach strenger Auffassung ist die Stellung des faktischen Geschäftsführers dann überragend, wenn er von den acht klassischen Merkmalen im Kernbereich der Geschäftsführung (Bestimmung der Unternehmenspolitik, Unternehmensorganisation, Einstellung von Mitarbeitern, Gestaltung der Geschäftsbeziehungen zu Vertragspartnern, Verhandlung mit Kreditgebern, Gehaltshöhe, Entscheidung der Steuerangelegenheiten, Steuerung der Buchhaltung) mindestens sechs erfüllt“
Hieran hat sich im Folgenden auch die weitere Rechtsprechung orientiert. Die Erfassung auch des faktischen Geschäftsführers entspricht gefestigter Rechtsprechung.
Firmenbestattung und Insolvenzstrafrecht
Auch sogenannte Firmenbestattungen sind nach wie vor verbreitet. Hierunter versteht man die Abwicklung eines meist insolvenzreifen Unternehmens unter Umgehung der insolvenzrechtlichen Vorschriften und Verfahren. Zu diesem Zweck werden die Anteile des meist bereits insolventen Unternehmens an einen Dritten veräußert. Die Veräußerung dient dabei häufig der Verschleierung der tatsächlichen Verantwortlichkeiten. Ein Insolvenzantrag wird in aller Regel durch den Erwerber bzw. den formellen Geschäftsführer nicht gestellt. Die in der Praxis vorkommenden Fallgestaltungen sind dabei vielgestaltig. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass gezielt Verantwortlichkeiten verschleiert werden sollen. Die Firmenbestattung ist daher grundsätzlich als Verschleiern von geschäftlichen Verhältnissen im Sinne des § 283 Abs. 1 Nr. 8 StGB strafbar.
Sachverhalt der Entscheidung
Nach den Feststellungen des Landgerichts war der Angeklagte als sogenannter Firmenbestatter tätig. Als formalen Geschäftsführer setzte er regelmäßig einen geschäftlich völlig unerfahren Strohmann ein. Dieser war lediglich formal tätig. Einfluss auf die verbleibenden Geschäfte der Gesellschaft nahm er nicht. Insbesondere hatte er keine Entscheidungskompetenz, sondern ordnete sich dem Angeklagten vollständig unter. Er leistete Blankounterschriften und wurde mit kleinen Botengängen betraut.
Entscheidung des Landgerichts: Beihilfe
Das Landgericht hatte den angeklagten Firmenbestatter auf dieser Grundlage lediglich wegen Beihilfe verurteilt. Eine täterschaftliche Verurteilung scheide aus, da der Angeklagte von den klassischen Merkmalen eines faktischen Geschäftsführers nicht die Mehrzahl erfüllt habe. Es habe insbesondere nicht geklärt werden können, ob dieser nach außen für die Gesellschaften aufgetreten sei.
Entscheidung des BGH
Der BGH hob diese Entscheidung auf und verhalf der staatsanwaltschaftlichen Revision zum Erfolg. Die Begründung des Landgerichts erweisen sich als nicht tragfähig.
Faktischer Geschäftsführer: keine schematische Betrachtung
Bei der Subsumtion unter dem Begriff des faktischen Geschäftsführers komme es nicht auf das „schematische Abarbeiten eines Kriterienkatalogs” (Rn. 15) an. Auch habe das Landgericht aus dem Blick verloren, das Ziel der Übernahmen eine Firmenbestattung gewesen sei. Es sei lediglich darum gegangen, den betroffenen Unternehmen verbliebene Vermögenswerte zu entziehen und so ihre Gläubiger zu benachteiligen. Eine echte wirtschaftliche Geschäftstätigkeit hätten die Unternehmen nicht mehr entfaltet. Daher seien einzelne der herkömmlichen Kriterien der Rechtsprechung ohne Aussagekraft – etwa die fehlende Einstellung von Mitarbeitern.
Auftreten für die Gesellschaft im Außenverhältnis
Auch der Umstand, dass ein Auftreten des Angeklagten wie Gesellschaften im Außenverhältnis nicht habe festgestellt werden können, sei nicht entscheidend. Bei dieser handelt es sich zwar um eine ganz wesentliche Funktion des Geschäftsführers. Bloß interne Einflussnahme – etwa eines bestimmenden Gesellschafters – begründe nicht die Stellung als faktischer Geschäftsführer. Gerade im Falle der Firmenbestattung gelte Folgendes (Rn. 20):
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit faktischer Organe beruht nicht auf einem durch einen bestimmten Außenauftritt begründeten Rechtsschein, sondern auf der rein tatsächlichen Übernahme der Organstellung. Ob jemand die Rolle des Vertretungsorgans faktisch übernommen hat, kann nur im Rahmen einer Gesamtschau der konkreten Verhältnisse der jeweiligen Gesellschaft beurteilt werden (siehe oben b), weshalb die Urteilsfeststellungen ein „Bild“ von diesen ergeben müssen […]. Wenn die Gesellschaft überhaupt nur noch in geringem Maße oder gar nicht mehr am Rechtsverkehr teilnimmt, hat das Fehlen einer Vertretung nach außen nur sehr begrenzte Aussagekraft. Die für werbende Unternehmen entwickelten Kriterien können nur eingeschränkt Anwendung finden, wenn der Unternehmenszweck nur noch in der Abwicklung der Geschäftstätigkeit besteht.
Bedeutung für das Insolvenzstrafrecht
Die Entscheidung hat große Bedeutung für das Insolvenzstrafrecht. Der Begriff des faktischen Geschäftsführers wird mit Blick auf Firmenbestattungen ausgeweitet. Diese gerät noch klarer als bislang ohnehin schon in das Blickfeld der Ermittlungsbehörden. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit etwa des im Hintergrund stehenden Firmenbestatters wird deutlich ausgedehnt. Inwieweit dies in der Praxis auch zu einer Zunahme der Verfolgungstätigkeit führen wird, bleibt abzuwarten.
Kritik: unklarer Begriff des faktischen Geschäftsführers
Die Entscheidung verdeutlicht erneut, dass es sich bei der Rechtsfigur des faktischen Geschäftsführers um richterrechtliches Institut handelt. Das Bestreben, dieser durch festgelegte Kriterien im einzelnen Konturen zu verleihen, ist dabei nur zu begrüßen. Immerhin sind die Rechtsfolgen teilweise erheblich. Es mag auch angemessen sein, die Bedeutung einzelner Kriterien in bestimmten Fallgestaltungen abweichend zu bewerten. Eine Gesellschaft im Abwicklungsstadium wird tatsächlich anders zu beurteilen sein als ein geschäftlich aktives Unternehmen.
Gefahr einer Ausdehnung der Strafbarkeit
Auf der anderen Seite birgt die Entscheidung aber auch die Gefahr einer Ausdehnung der Strafbarkeit ohne klar nachvollziehbare Voraussetzungen und Grenzen. Wenn die Rechtsprechung auf eine „Gesamtschau der konkreten Verhältnisse der jeweiligen Gesellschaft“ abstellen will, fehlt es gerade an konkreten und vorhersehbaren Voraussetzungen der Strafbarkeit. Dies ist mit Anforderung an die Gesetzesbestimmtheit im Strafrecht nur schwer vereinbar. Insbesondere droht eine ähnliche Herangehensweise auch in anderen Konstellationen. Dies macht die strafrechtliche Verantwortlichkeit gegebenenfalls schwer vorhersehbar.