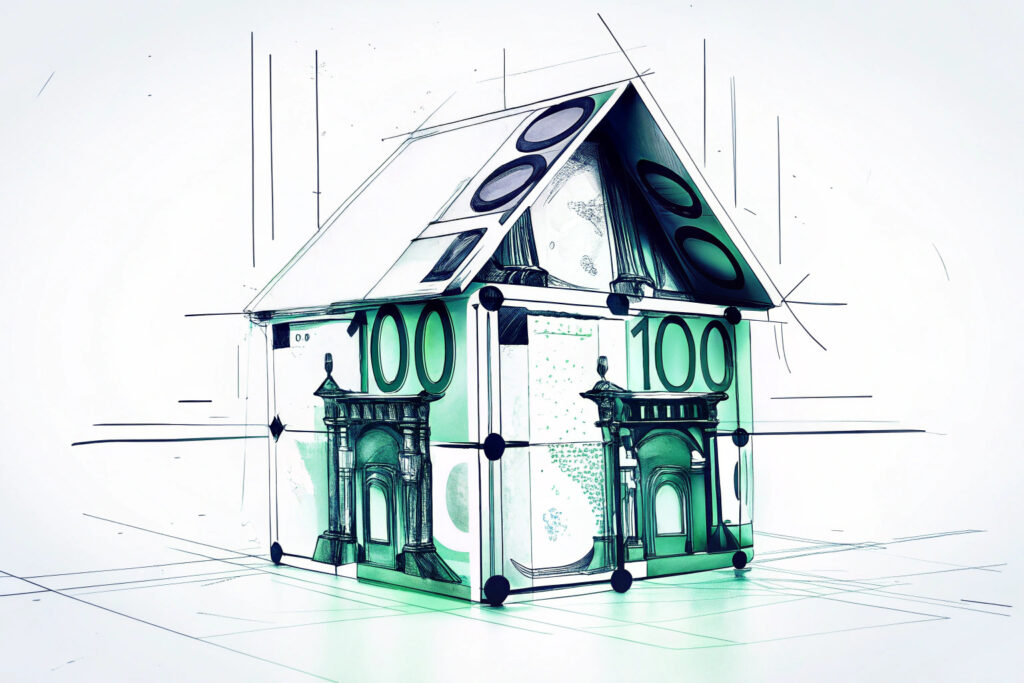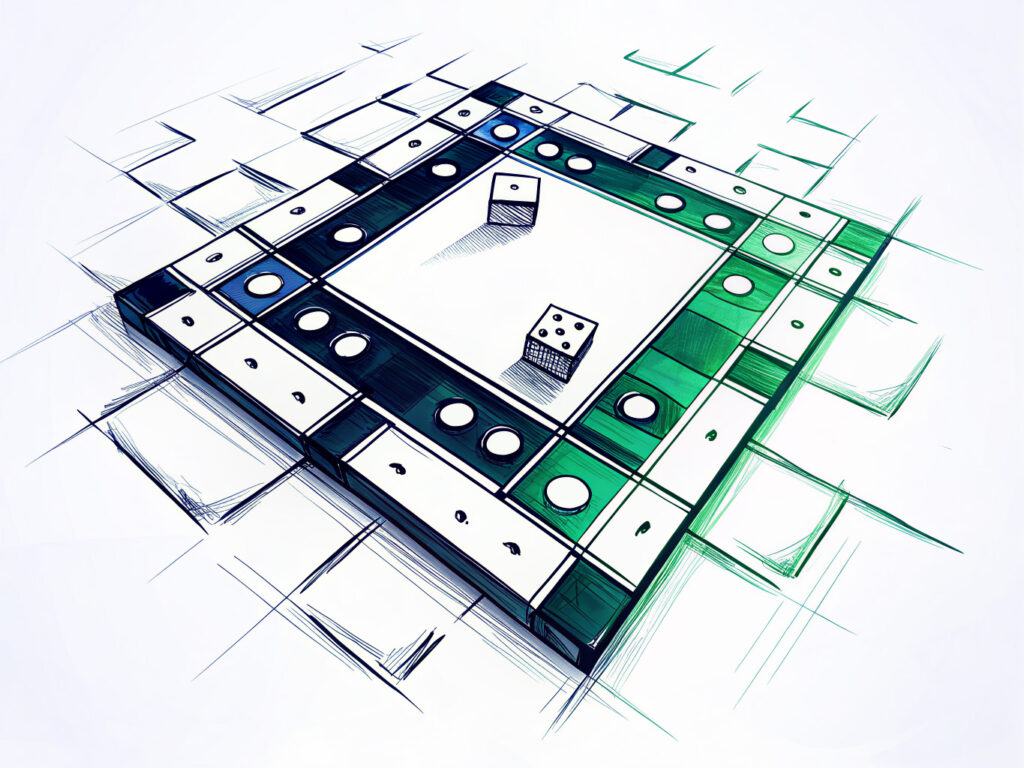§ 261 Abs. 1 Nr. 1 StGB stellt das Verbergen eines Vermögensgegenstandes, welcher aus einer rechtswidrigen Tat herrührt, unter Strafe. § 261 Abs. 2 StGB enthält eine Strafvorschrift, welche gerade die Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögensgegenstände erfasst; hiernach wird bestraft,
wer Tatsachen, die für das Auffinden, die Einziehung oder die Ermittlung der Herkunft eines Gegenstands nach Absatz 1 von Bedeutung sein können, verheimlicht oder verschleiert.
Dies knüpft wiederum an Grundbegriffe der Strafvorschrift der Geldwäsche an – insbesondere denjenigen des aus einer rechtswidrigen Tat herrührenden Gegenstandes. Darüber hinaus stellt sich im Einzelfall konkret die Frage, was ein Verheimlichen und Verschleiern tatbestandlich voraussetzen.
Diesen Fragen soll im Folgenden nachgegangen werden. Daneben soll auch einige weitere zentrale Gesichtspunkte der Vorschrift des § 261 StGB hingewiesen werden. Schließlich wird auf mögliche Verteidigungsansätze und -chancen eingegangen.
Tatbestand der Geldwäsche nach § 261 StGB
Der Tatbestand der Geldwäsche hat, insbesondere nach den jüngsten gesetzgeberischen Änderungen, eine enorme Reichweite. Mittlerweile reicht es aus, wenn der betroffene Gegenstand aus irgendeiner rechtswidrigen Tat herrührt. Nicht mehr erforderlich ist die Feststellung einer sogenannten Katalogtat, wie dies der bisherigen Rechtslage entsprach. Dies stellt eine ganz erhebliche, in ihren Auswirkungen noch nicht übersehbare Ausweitung dar.
Tatgegenstand der Geldwäsche
Tatgegenstand der Geldwäsche kann jeder Vermögenswert sein. Dies erfasst in erster Linie Bargeld und Buchgeld. Daneben kommen aber alle anderen Vermögenswerte ebenso in Betracht: etwa Rechte, Forderungen, Kryptowährungen und sonstige elektronische Zahlungsmittel, etc. Das Geldwäscherecht ist insofern bewusst weit ausgestaltet – Ziel der Vorschrift ist es, möglichst weitläufig alle nur denkbaren Vermögenswerte zu erfassen, welche aus Straftaten stammen.
Herrühren aus einer rechtswidrigen Tat
Die Strafvorschrift der Geldwäsche erfordert, dass das Herrühren des Gegenstandes aus einer Straftat feststellbar ist. Dies setzt allerdings lediglich einen gewissen wirtschaftlichen Zusammenhang voraus. Erforderlich ist, dass sich der Vermögenswert bei wirtschaftlicher Betrachtung auf die Vortat zurückführen lässt. Dies erfasst auch Surrogate und sonstige wirtschaftliche Vorteile, die mittelbar aus der Tat gezogen werden. Verwiesen sei beispielsweise auf den Erlös aus dem Verkauf unterschlagener Gegenstände, oder den Gegenwert betrügerisch erlangter Krypto-token.
Insbesondere bei Kontoguthaben ist auch auf die Theorie der Totalkontamination hinzuweisen. Hiernach ist ein Kontoguthaben insgesamt als bemakelt anzusehen, wenn der aus Straftaten herrührende Anteil nicht ganz unerheblich ist. Dies führt im Einzelfall zu einer gravierenden Ausweitung der Strafbarkeit, da das gesamte Kontoguthaben (und nicht lediglich der betroffene Anteil) als bemakelt anzusehen sein soll.
Vorsatz und Leichtfertigkeit
In subjektiver Hinsicht setzt der Tatbestand lediglich bedingte Vorsatz voraus. Es genügt beispielsweise etwa, wenn der Handelnde die Möglichkeit einer rechtswidrigen Herkunft des Gegenstandes erkennt, und sich mit dieser abfindet. Die Grenzziehung zur bewussten Fahrlässigkeit ist dabei schwierig. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass § 261 Abs. 6 StGB eine Strafbarkeit wegen leichtfertige Geldwäsche vorsieht.
Verbergen eines Gegenstandes (§ 261 Abs. 1 Nr. 1 StGB)
Der Grundtatbestand der Geldwäsche nach § 261 StGB enthält in den Nr. 1 bis 4 eine Vielzahl unterschiedlicher Tathandlungen. Unter Nummer 1 findet sich das Verbergen eines aus einer rechtswidrigen Tat stammenden Gegenstandes. Verbergen bedeutet dabei jedes zielgerichtete Vorgehen, durch welches das Auffinden des Gegenstandes verhindert werden soll. Zentral ist dabei, dass der behördliche Zugriff auf den jeweiligen Vermögenswert – insbesondere durch Ortsveränderung – erschwert wird. Wer etwa Bargeld aus Drogengeschäften in einem Schließfach versteckt, verbirgt im Sinne des § 261 Abs. 1 Nr. 1 StGB. Oft wird für das Verbergen eine gewissen manipulative Tendenz – und mithin ein zielgerichtetes Handeln – verlangt. Dabei ist es nicht erforderlich, dass der Aufbewahrungsort des Gegenstandes verändert wird. So kann es auch ausreichen, wenn das Auffinden auf sonstige Weise verhindert wird.
Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte (§ 261 Abs. 2 StGB)
§ 261 Abs. 2 StGB enthält darüber hinaus einen Tatbestand, nach welchen bestraft wird, wer auf einen Gegenstand im Sinne des Abs. 1 bezogene Tatsachen verheimlicht oder verschleiert. Auch dies soll nach der Gesetzesbegründung konkret irreführende, manipulierende Machenschaften erfassen. Die Vorschrift erfasst nicht lediglich das Verschleiern und Verheimlichen des Vermögenswertes selbst, sondern greift bereits im Vorfeld ein; schon Tatsachen, welche für das Auffinden von Bedeutung sind, können Gegenstand einer Tat nach § 261 Abs. 2 StGB sein. Auch dies bedeutet eine Erweiterung und Vorverlagerung der Strafbarkeit.
Besonders problematisch erscheint ein Verheimlichen durch bloßes Unterlassen. Dies lässt sich bereits im Ausgangspunkt mit der Forderung nach einem manipulativen Element schwer vereinbaren. Der bloße Verstoß gegen eine – wie auch immer geartete – Offenbarungs- bzw. Mitteilungspflicht wird hierfür nicht genügen. Ein Verheimlichen oder Verschleiern durch Unterlassen kann daher nur in Ausnahmekonstellationen angenommen werden.
Relevante Vortaten bei § 261 StGB
Nach der Neufassung der Strafvorschrift ist taugliche Vortat grundsätzlich jede rechtswidrige Tat im Sinne des Gesetzes. Dieser sogenannte all-crimes-approach hat zu einer wesentlichen Ausweitung der Strafbarkeit geführt.
Praktisch relevant sind als Vortaten insbesondere Betrugsdelikte und sonstige Vermögensdelikte. Immer dann, wenn der Vortäter sich Vermögenswerte durch eine Straftat verschafft, stellen sich im Weiteren Frage nach der Geldwäsche. So kommen auch Bestechungs- oder Umweltdelikte als Vortaten in Betracht. Wer etwa Profite eines Unternehmens weiterleitet oder verschleiert, obwohl er weiß, dass diese aus Umweltstraftaten stammen, macht sich naheliegend nach § 261 StGB strafbar.
Immer wieder werden auch gutgläubige Personen getäuscht, um die Weiterleitung von Beträgen über ihre Konten zu ermöglichen – sogenannte Finanzagenten.
Strafmaß & Rechtsfolgen der Geldwäsche
All dies wirft den Blick auf die Rechtsfolgen der Geldwäsche. Wie wird Geldwäsche nach § 261 StGB bestraft?
Strafrahmen der Geldwäsche
Die strafrechtlichen Folgen können einer Tat nach § 261 StGB können erheblich sein. Bereits der Grundtatbestand sieht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder Geldstrafe vor. In besonders schweren Fällen reicht der Strafrahmen nach § 261 Abs. 5 StGB und sechs Monaten bis zu zehn Jahren; nach § 261 Abs. 5 S. 2 StGB liegt ein besonders schwerer Fall in der Regel dann vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt.
Strafzumessungspraxis
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die im Gesetz vorgesehenen Strafrahmen grundsätzlich sämtliche vorkommenden Fälle der Geldwäsche abbilden. Hieraus erklärt sich auch ihre Weite. In der Regel werden auch Straftaten nach § 261 StGB mit Geldstrafen geahndet. Auch diese können angesichts der Orientierung am Einkommen des Täters empfindlich sein. Haftstrafen werden bei besonders hohen Summen oder einschlägigen Vorstrafen in Betracht kommen.
Hinzu kommt, dass auch außerstrafrechtliche Folgen drohen können. Dies kann von berufsrechtlichen Konsequenzen über den Widerruf von Erlaubnissen (etwa des Jagd- bzw. Waffenscheins) bis hin zu gewerberechtlichen Konsequenzen führen.
Einziehung: finanzielle Folgen der Geldwäsche
Die finanziellen Folgen einer Verurteilung wegen Geldwäsche können erheblich sein. Dies beruht zuallererst darauf, dass im Wege der Einziehung das „Erlangte“ beim Täter eingezogen wird. Erlangt ist (im Prinzip) alles, was dem Täter während irgendeiner Phase der Tatbegehung zugeflossen ist. Dies bedeutet in Fällen der Geldwäsche, dass regelmäßig der entgegengenommene Vermögenswert als solcher eingezogen wird. Ist der Gegenstand nicht mehr im Vermögen vorhanden, kommt eine Wertersatzeinziehung in Betracht. Dies bedeutet etwa bei einem Finanzagenten, dass die Einziehung auch in Höhe der weitergeleiteten Gelder erfolgen kann.
Möglichkeiten zur Strafbefreiung (§ 261 Abs. 8 StGB)
§ 261 Abs. 8 StGB sieht die Möglichkeit einer Selbstanzeige vor. Hiernach wird derjenige nicht bestraft, der eine Straftat nach § 261 StGB anzeigt, bevor diese entdeckt ist, und an der Sicherstellung des betreffenden Gegenstandes mitwirkt. Die Regelung ist dabei der steuerstrafrechtlichen Selbstanzeige nachgebildet.
Selbstgeldwäsche (§ 261 Abs. 7 StGB)
Eine weitere Besonderheit enthält § 261 Abs. 7 StGB. Hiernach kann auch derjenige, der an der Vortat der Geldwäsche beteiligt ist, sich wegen sogenannter selbst Geldwäsche strafbar machen. Grundsätzlich soll der Vortatbeteiligte keiner Strafbarkeit aus § 261 StGB unterliegen, da das Unrecht der Tat bereits erfasst ist. Etwas anderes soll allerdings dann gelten, wenn er den Tatgegenstand in Verkehr bringt und dabei dessen rechtswidrige Herkunft verschleiert. Nach der Wertung des Gesetzgebers liegt in diesen Fällen ein eigenständiges strafrechtliches Unrecht vor.
Das Verschleiern der rechtswidrigen Herkunft setzt dabei ein manipulatives und täuschendes Verhalten voraus. Wer etwa gegenüber der Bank unter Vorlage gefälschter Unterlagen eine rechtmäßige Herkunft zu belegen versucht, kann wegen Selbstgeldwäsche strafbar. Die Einzelheiten sind hierbei noch ungeklärt; es ist aber durchaus damit zu rechnen, dass die Rechtsprechung auch hier eine extensive Auslegung finden und verfolgen wird.
Verteidigungsstrategien
Welche Verteidigungsstrategien gibt es? Wie verhält sich ein Beschuldigter am Besten?
Zunächst sind auch bei Vorwürfen der Geldwäsche die allgemeinen Hinweise immer richtig: Vorschnelle und verfrühte Reaktionen sind riskant. Stets empfiehlt es sich, zunächst von dem Schweigerecht Gebrauch zu machen. Es handelt sich hierbei um ein grundlegendes Recht des Beschuldigten; die Ermittlungsbehörden dürfen keine nachteiligen Schlüsse aus der Berufung auf das Schweigerecht ziehen.
Individuelle Verteidigungsstrategie nach Akteneinsicht
Eine konkrete Verteidigungsstrategie kann nur nach eingehender Analyse der Akten entworfen werden. Erst wenn die Vorwürfe konkret bekannt sind, kann ihnen wirksam entgegengetreten werden. Welche Beweismittel liegen vor? Was ist zu den angeblichen Vortaten bekannt? Wie soll die subjektive Tatseite belegt werden?
Es gibt in der Strafverteidigung keine schematischen Lösungen.
Insofern ist darauf hinzuweisen, dass im Strafrecht die Ermittlungsbehörden den Nachweis eines strafrechtlich relevanten Verhaltens zu führen haben. Im Zweifel ist für den Angeklagten zu entscheiden. Andererseits darf dies in der Praxis auch nicht überschätzt werden. So reicht es aus, wenn ein Bericht auf rational nachvollziehbarer Tatsachengrundlage einen möglichen Schluss auf die Schuld des Angeklagten zieht. Gerade in subjektiver Hinsicht – mit Blick auf das Wissen des Handelnden – bietet dies den Gerichten einen erheblichen Spielraum.
Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, insb. §§ 153ff. StPO
Das Wirtschaftsstrafrecht zeichnet sich zum einen allerdings dadurch aus, dass rechtliche Einwendungen erhoben werden können. Dies gilt auch und gerade für den Tatbestand der Geldwäsche. Zum anderen enden viele Verfahren mit einer Einstellung, etwa nach § 153a StPO (Einstellung gegen Zahlung einer Geldauflage).
Fazit: Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte
Die Bedeutung des § 261 StGB wächst und wächst. Auch die neusten Entwicklungen – etwa im Koalitionsvertrag angekündigte Vorhaben – lassen eine weitere Ausdehnung der Vorschriften erwarten. Debattiert werden insbesondere weitere Verschärfungen des ohnehin einschneidenden Einziehungsrechts. Die kriminalpolitische Zielrichtung ist dabei eindeutig: Stets geht es um eine Ausweitung und Verschärfung der bestehenden Regelung. Auch die Fallzahlen bei den Behörden des Zolls steigen weiterhin. Gleiches gilt für Verdachtsanzeigen nach dem Geldwäschegesetz.
Ein zentraler Begriff ist dabei immer wieder die Verschleierung von unrechtmäßigen Vermögenswerten. Die Rechtsprechung folgt dabei der vorgegebenen kriminalpolitischen Tendenz. Umso wichtiger ist eine frühzeitige und spezialisierte Verteidigung.