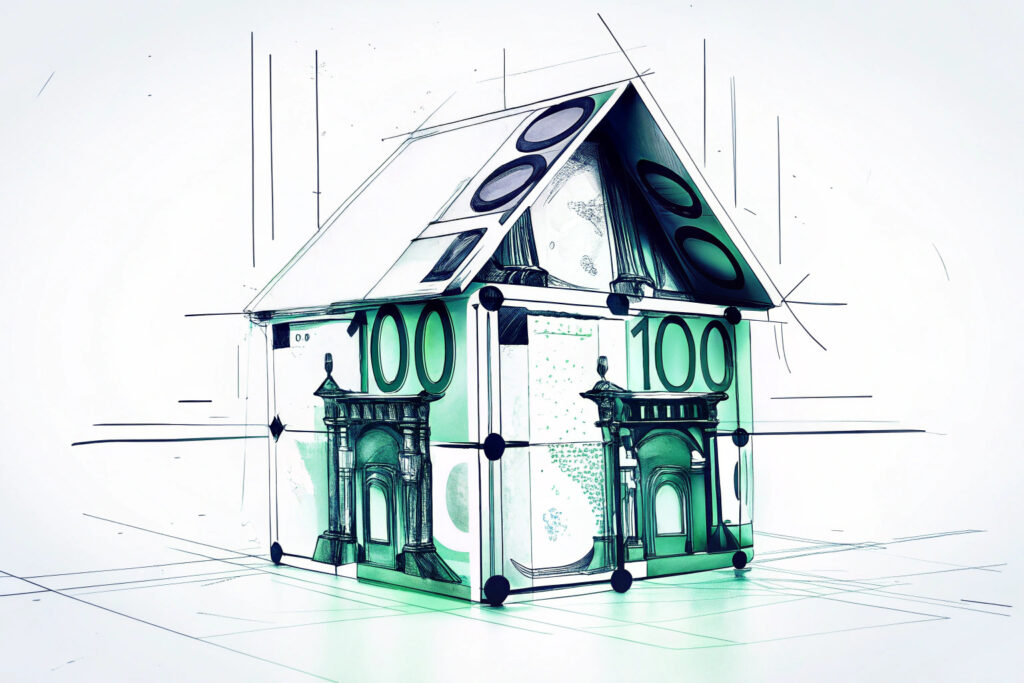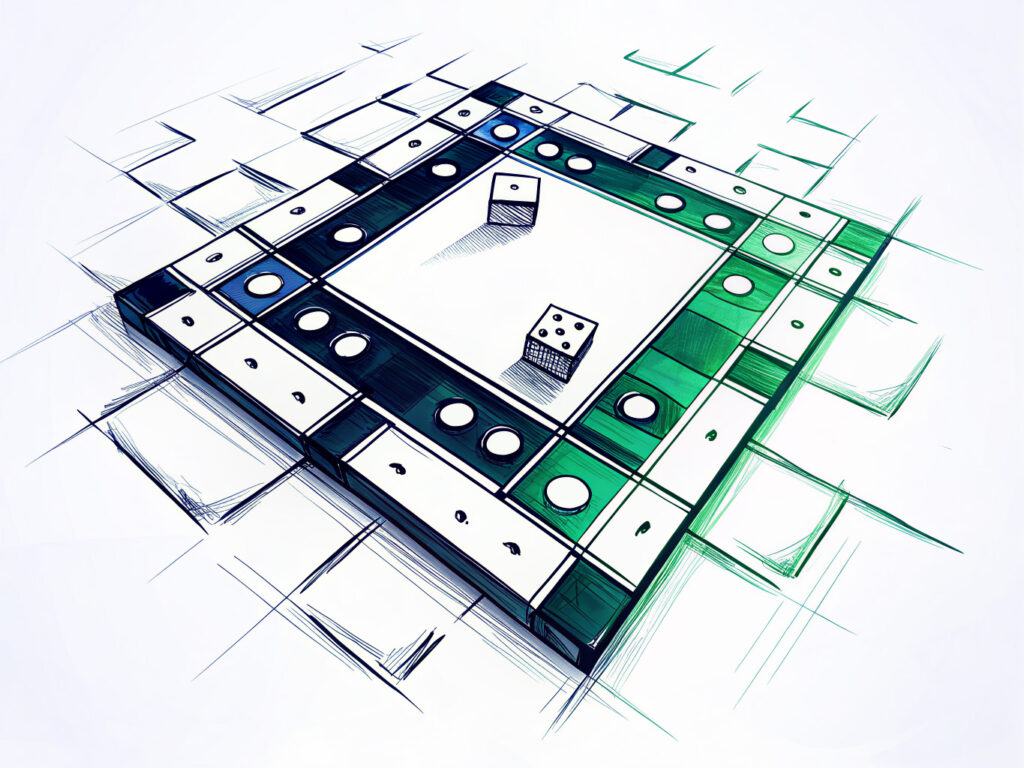Eine solche „Kontosperrung“ kann aber auch auf einen strafprozessualen Arrest (§ 111c StPO) zurück gehen. Dies setzt jedoch ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren und einen amtsgerichtlichen Beschluss voraus. Im Folgenden soll ein knapper Überblick über die unterschiedlichen Voraussetzungen und Anforderungen der einzelnen Maßnahmen erfolgen. Abschließend soll darauf hingewiesen werden, wie sich der Betroffene gegen entsprechende Maßnahmen zur Wehr setzen kann.
Kontosperrung: Maßnahmen auf Basis des Geldwäschegesetzes
§ 43 GwG regelt die Pflicht zur Abgabe von Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz. Eine solche Meldepflicht liegt immer dann nahe, wenn Tatsachen darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand aus einer rechtswidrigen Tat stammt. Die Einzelheiten des Meldeverfahrens werden im sechsten Abschnitt des GwG geregelt.
Verdachtsmomente nach dem GwG
Die Meldepflicht des § 43 GwG knüpft dabei an bestimmte Verdachtsmomente an. Als solche kommen eine Vielzahl tatsächlicher Umstände in Betracht – etwa auffällige Bareinzahlungen, die Einschaltung bestimmter Zahlungsdienstleister, eine Vielzahl ungewöhnlicher Transaktionen, etc. Insofern kann auch auf Anlage 2 zu den §§ 5, 10, 14, 15 GwG, in welcher sich bestimmte risikoerhöhende Faktoren finden, verwiesen werden.
Die Vorschrift des § 46 GwG enthält ein Verbot der Transaktion innerhalb der bezeichneten Frist von drei Werktagen. Nach § 47 Abs. 1 GwG darf der Verpflichtete dem Betroffenen auch keine Auskunft zu den Hintergründen der Verdachtsanzeige erteilen.
Transaktionsverbot nach § 46 GwG
§ 46 GwG enthält ein zeitlich begrenztes Transaktionsverbot. Die Vorschrift lautet im Wesentlichen wie folgt:
„(1) Eine Transaktion, wegen der eine Meldung nach § 43 Absatz 1 erfolgt ist, darf frühestens durchgeführt werden, wenn
1.
dem Verpflichteten die Zustimmung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen oder der Staatsanwaltschaft zur Durchführung übermittelt wurde oder
2.
der dritte Werktag nach dem Abgangstag der Meldung verstrichen ist, ohne dass die Durchführung der Transaktion durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen oder die Staatsanwaltschaft untersagt worden ist.“
Der Begriff der Transaktion ist dabei weit zu verstehen (§ 1 Abs. 5 GwG).
Zeitliche Grenzen des Transaktionsverbots
Darüber hinaus ermächtigt die Vorschrift des § 46 GwG nicht dazu, eine Transaktion zu untersagen. Dies kann über die Vorschrift des § 40 GwG oder einen strafprozessualen Arrest (s. u.) erfolgen. Insbesondere erlaubt § 46 GwG es der Staatsanwaltschaft nicht, die Transaktion einstweilen durch formlose Erklärung gegenüber der meldenden Stelle – in der Regel der Bank – zu untersagen (Herzog/Barreto da Rosa GwG § 46 Rn. 11). In der Praxis ist dies teilweise zu beobachten; rechtlich dürften entsprechende Schreiben ohne Wirkung sein. Faktisch werden diese oft ausreichen, da die Bank die Ausführung der Transaktion jedenfalls verzögern wird.
Nach Ablauf der Frist des § 46 GwG darf die Transaktion grundsätzlich ausgeführt werden, es sei denn, es liegen eine Untersagungsverfügung oder ein strafprozessualer Arrest vor (LG Wiesbaden, Urteil vom 11. Januar 2024 – 3 O 238/23 –, juris; siehe auch: LG Frankfurt, Beschluss vom 22. Januar 2024 – 2-01 T 26/23, LG Hamburg, Urteil vom 15. Dezember 2023 – 415 HKO 33/23). Fehlt es an entsprechenden Maßnahmen, steht es nicht im Belieben der Bank, die Transaktion – etwa die Auszahlung und Weiterleitung von Geldern – weiter zu verzögern.
Auch ein staatsanwaltschaftliches Schreiben, in welchem gebeten wird, eine Transaktion nicht auszuführen, da Arrestmaßnahmen geplant seien, ist rechtlich nicht verbindlich. Rein praktisch wird die Bank vielfach jedenfalls teilweise von der Ausführung der Transaktion absehen. Der Kunde hat gegebenenfalls gegen die Bank einen entsprechenden zivilrechtlichen Anspruch. Verletzt die Bank zivilrechtliche Pflichten aus dem Vertragsverhältnis, macht sie sich gegebenenfalls schadensersatzpflichtig.
Sofortmaßnahmen nach § 40 GwG
Nach § 40 Abs. 1 GwG kann die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen einem Verpflichteten untersagen, eine bestimmte Transaktion durchzuführen. Dies kann beispielsweise zulässig sein, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Transaktion im Zusammenhang mit Geldwäsche steht. § 40 Abs. 1 S. 1 GwG lautet wie folgt:
Liegen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Transaktion im Zusammenhang mit Geldwäsche oder einer Straftat nach § 18 Absatz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes steht oder der Terrorismusfinanzierung dient, so kann sie die Durchführung der Transaktion untersagen, um diesen Anhaltspunkten nachzugehen und die Transaktion zu analysieren.
Maßnahmen nach § 40 Abs. 1 GwG enden nach § 40 Abs. 4 GwG spätestens nach Ablauf eines Monats seit Anordnung (Nr. 1) oder mit Ablauf des fünften Werktages nach Abgabe zuständige Strafverfolgungsbehörde (Nr. 2). Dies ermöglicht im Einzelfall immerhin ein bis zu 30 Tage währendes Transaktionsverbot, mithin einen einschneidenden Eingriff.
Vorgehen gegen Maßnahmen nach dem GwG
Eine Sofortmaßnahme nach § 40 GwG stellt einen Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG dar. Gegen diesen kann der Betroffene im Wege des Widerspruchs und der Anfechtungsklage vorgehen. Adressat des Verwaltungsakts ist regelmäßig der nach dem Geldwäschegesetz Verpflichtete, welchem etwa die Ausführung einer Überweisung untersagt worden ist. Der Kontoinhaber hat als Betroffener der Maßnahme jedoch ebenfalls ein Widerspruchsrecht. Der Widerspruch hat nach § 40 Abs. 6 S. 2 GwG keine aufschiebende Wirkung. Diese kann nur vom Gericht der Hauptsache angeordnet werden, § 80 Abs. 5 VwGO. Dies wird regelmäßig voraussetzen, dass sich die Maßnahme bei vorläufiger Würdigung als rechtswidrig erweist und daher die Interessen des Betroffenen überwiegen. Die Hürden für den Antragssteller sind daher hoch (vgl. VG Köln, Beschluss vom 17. Mai 2019 – 14 L 1066/19 –, juris).
Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens?
Viele Ermittlungsverfahren werden inzwischen aufgrund von Geldwäscheverdachtsanzeigen nach § 43 GwG eingeleitet. Wenn daher bereits Sofortmaßnahmen nach § 40 GwG ergriffen worden sind, liegt es nahe, dass im weiteren auch strafrechtliche Ermittlungen erfolgen oder bereits eingeleitet sind. Etwas anderes kann gelten, wenn sich die Verdachtsmomente der Aufsichtsbehörden ohne Weiteres als unbegründet herausstellen. Es empfiehlt sich jedoch stets, spezifisch strafrechtlichen Rat hinzuzuziehen. Selbst soweit es sich noch um ein bankrechtliches oder aufsichtsrechtliches Problem handelt, stellen sich regelmäßig bereits Fragen nach der strafrechtlichen Würdigung.
Strafprozessualer Vermögensarrest nach StPO
Ein strafprozessualer Arrest kommt in Betracht, wenn der Verdacht besteht, dass einzelne Vermögenswerte der Einziehung nach §§ 73 ff. StGB unterliegen werden. Ist dies aufgrund bestimmter Tatsachen der Fall, kann das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Beschluss erlassen. Ein solcher Beschluss wird regelmäßig durch Pfändung des Kontoguthabens vollstreckt. Insgesamt dient das Arrestverfahren der Sicherung von Vermögensgegenständen, welche nach dem bestehenden Tatverdacht der Einziehung unterliegen könnten.
Voraussetzung des Arrests
Ein strafprozessualer Arrest setzt jedoch den Verdacht einer Straftat voraus. Der Sachverhalt muss von den Ermittlungsbehörden – jedenfalls in Grundzügen – bereits ermittelt sein. Eine bloße Vermutung ist nicht geeignet, ein Tatverdacht zu begründen. In der Praxis werden entsprechende Arrestbeschlüsse oft schnell erlassen, beispielsweise auch dann, wenn zu den angeblichen Vortaten noch nichts bekannt ist.
Für Arrestbeschlüsse gelten verfassungsrechtliche Mindestanforderungen. Diese müssen insbesondere den zugrunde liegenden Tatverdacht hinreichend klar umschreiben. In der Praxis darf die grundrechtsschützende Funktion des Richtervorbehalts allerdings nicht überschätzt werden. Nicht selten werden Arrestschlüsse in einem frühen Ermittlungsstadium aufgrund einiger weniger Verdachtsmomente erlassen. Die Ermittlungsbehörden sind dabei insbesondere bestrebt, Vermögenswerte zu sichern bzw. deren Transfer ins Ausland zu verhindern.
Vorgehen gegen einen strafprozessualen Arrest
Der Betroffene kann sich gegen einen strafprozessualen Arrest nach den allgemeinen Regeln wenden. Ist der Arrest einmal vollzogen, wird dieser dem Betroffenen offengelegt. Der Arrest kann sich dabei gegen den Beschuldigten selbst richten oder auch gegen Dritte, denen im Zusammenhang mit der Straftat Vermögenswerte zugeflossen sind.
Zulässiges Rechtsmittel ist die Beschwerde nach §§ 304ff. StPO. Zur Begründung der Beschwerde ist Akteneinsicht unverzichtbar. Versagt die Staatsanwaltschaft diese unter Berufung auf eine angebliche Gefährdung des Ermittlungszwecks, so kann der Arrest nicht aufrechterhalten werden. Dieser kann nur auf Beweismittel gestützt werden, die dem Betroffenen auch bekannt sind.
Überprüfung durch das Beschwerdegericht
Im Beschwerdeverfahren wird die Rechtmäßigkeit des strafprozessualen Arrests durch das Beschwerdegericht überprüft. Dieses überprüft etwa, ob der Verdacht eines strafbaren Handelns durch das Ermittlungsergebnis begründet ist und ob die gesicherten Vermögensgegenstände auf dieser Grundlage aus der behaupteten Straftat stammen.
Mit Blick auf Vorwürfe der Geldwäsche nach § 261 StGB setzt dies – auch nach der Neufassung des Tatbestandes – den Verdacht irgendeiner Vortat voraus (LG Saarbrücken, Beschluss v. 18.7.2024 – 13 Qs 19/24). Ist in keiner Weise bekannt, woher der Vermögenswert stammt, besteht kein Tatverdacht. In solchen Fällen kann allerdings ein sogenanntes selbstständiges Einziehungsverfahren (§ 76a Abs. 4 StGB) in Betracht kommen.
Daneben ist Voraussetzung eines strafprozessualen Arrests auch grundsätzlich ein Sicherungsbedürfnis. Dieses wird von der Praxis sehr weitreichend bejaht. Es versteht sich allerdings nicht von selbst.
Solange ein Konto vom Arrest betroffen ist, kann der Kontoinhaber über der das entsprechende Guthaben nicht verfügen. Gerade bei Unternehmen kann dies schnell zu massiven wirtschaftlichen Folgen führen – bis hin zur Insolvenz. Auch wenn die Zahlungsunfähigkeit auf einen strafprozessualen Arrest zurückgeht, sind etwa die Geschäftsführer zur Stellung eines Insolvenzantrages verpflichtet. Problematisch sind insofern die Zeitabläufe. Eine Anfechtung des Arrests binnen der kurzen insolvenzrechtlichen Fristen wird in aller Regel nicht gelingen.
Beschuldigter eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens?
Mit dem Arrestbeschluss ist regelmäßig auch klar, ob der Betroffene Beschuldigter eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ist. Wenn dies der Fall ist, gelten die allgemeinen Hinweise. Entscheidend ist eine möglichst frühzeitige Verteidigung. Ausgangspunkt jeder Verteidigung ist dabei die Einsicht in die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft. Eine Äußerung zum Sachverhalt vor Aktenkenntnis verbietet sich grundsätzlich. Zu berücksichtigen ist insofern insbesondere auch, dass ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren im Bereich der Geldwäsche über die strafrechtliche Einziehung immer auch mit erheblichen finanziellen Risiken belastet ist. Diese sollten frühzeitig in den Blick genommen werden.
Zusammenfassung
Im Zuge der immer weiter intensivierten Geldwäscheaufsicht kommt es zunehmend zu Kontosperrungen. Diese können einerseits auf dem Geldwäschegesetz beruhen, andererseits auf einen strafprozessualen Arrest zurückgehen. Die jeweiligen Maßnahmen unterscheiden sich in ihren Voraussetzungen und Anforderungen. Vielfach lassen sich die zentralen Aspekte aber kaum voneinander trennen. Die Frage nach der strafrechtlichen Würdigung und etwaigen strafrechtlichen Risiken wird sich bereits frühzeitig stellen. Neben der bankrechtlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Beratung sollte bereits frühzeitig strafrechtlicher Rat eingeholt werden.